Wie geht's? – Eine Frage, die keine Antwort will
„Wie geht’s?“ – die höflichste Flucht der Gegenwart. Über Smalltalk und Depression, über Reizüberflutung, Helfen und Zuhören – und darüber, warum es Mut braucht, einfach ehrlich zu bleiben, wenn die Welt nur schnelle Antworten will.
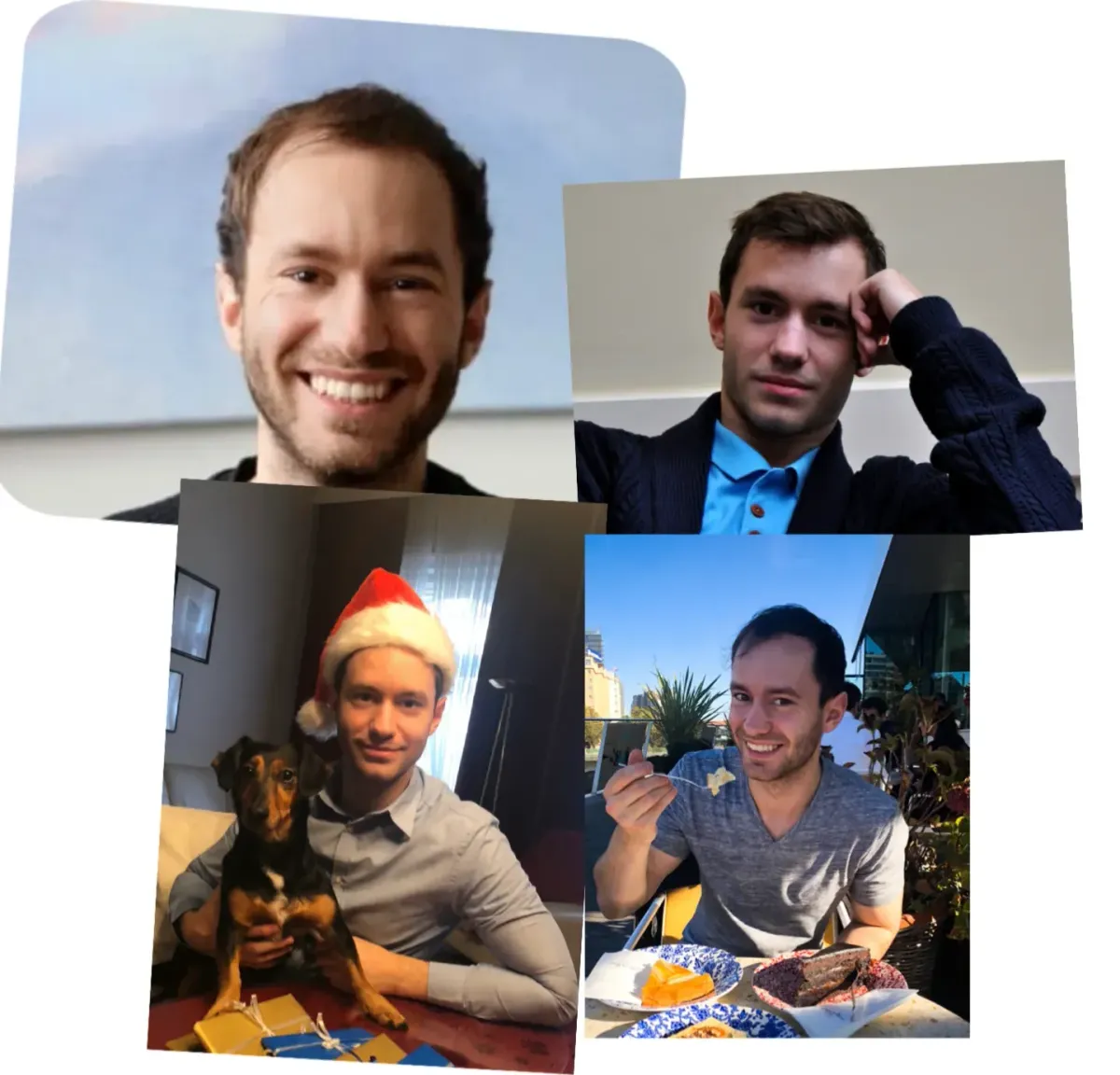
Die erste Fassung dieses Textes entstand ursprünglich als sehr persönlicher Tagebucheintrag auf meinem alten Blog. Ich habe ihn seither überarbeitet, erweitert und neu geordnet – nicht, weil sich die Gefühle verändert hätten, sondern weil sich mein Blick geschärft hat.
„Wie geht's?" – eine scheinbar harmlose Frage, die mich damals wie heute beschäftigt. Sie steht für Nähe, die nicht gelingt, und für die Mühe, ehrlich zu antworten. Vielleicht ist sie weniger eine Frage als ein Spiegel: Wie viel Echtheit halten wir wirklich aus?
In den Jahren seit der ersten Version habe ich viel über Depression gelernt. Über meine Depression. Über die Muster, die sich wiederholen. Über die Krisen, die kamen – manche schlimmer als damals. Und über die Wege, die wirklich helfen können. Nicht immer. Aber manchmal.
„Manchmal ist die ehrlichste Antwort auf ‚Wie geht's?' ein Schweigen."
[Die Veranstaltung]
„Komm mit, das wird dir guttun. Du musst mal wieder unter Leute."
Ich wollte nicht. Wirklich nicht. Aber ich dachte: Vielleicht hat er recht. Vielleicht muss ich einfach raus. Bewegung. Ablenkung. Irgendwas, das mich aus dem Bett holt. Also sagte ich zu.
Die Veranstaltung war ein Fehler. Zu viele Stimmen, zu viel Parfum, zu viel Licht. Alles vibrierte in meinem Kopf. Ich stand da mit einem Glas in der Hand und tat so, als würde ich dazugehören. Am Glasrand roch ich Zitrone und Metall. Es machte mich schwindelig. Aber ich war auf einer völlig anderen Wellenlänge. Die Gespräche um mich herum – oberflächlich, laut, belanglos – oder es fühlte sich so an. Vielleicht lag es auch nur an mir. Depression verzerrt die Wahrnehmung. Macht alles grau, macht alles anstrengend.
„Wie geht's dir eigentlich?"
Mein Begleiter. Zwischen zwei Gesprächen mit Leuten, die er kannte. Er schaute mich kurz an, aber sein Blick war schon wieder woanders. Sein Kopf war bei der Veranstaltung, beim Drumherum, bei allem außer bei mir. Die Frage war eine Floskel. Eine Höflichkeit. Keine echte Einladung.
Ich hätte sagen können: Schlecht. Ich halte das hier keine fünf Minuten mehr aus. Hätte sagen können: Ich bin nur hier, weil ich dachte, ich müsste unter Leute, aber das war ein Fehler. Hätte sagen können: Ich weiß nicht, wie ich durch die nächste Woche kommen soll.
„Passt schon."
Er nickte, lächelte, drehte sich weg. Abgehakt.
Zwischen uns blieb ein Stuhl frei, obwohl keiner da war.
Ich blieb noch eine halbe Stunde, dann erfand ich eine Ausrede und verschwand. Auf dem Heimweg entspannten sich meine Schultern. Gleichzeitig zog sich ein Knoten in meinem Magen zusammen. Warum bin ich so? Warum kann ich das nicht?
Später im Bett dachte ich: Er meinte es nicht böse. Er wollte wahrscheinlich wirklich wissen, wie es mir geht. Aber er hatte keine Zeit für die Antwort. Und ich hatte nicht die Kraft, sie ihm zu geben. (Und dass ich mir über solche Kleinigkeiten
[Die Mechanik des Smalltalks – was er verdeckt]
„Wie geht's?" ist die am häufigsten gestellte und am wenigsten gemeinte Frage unserer Zeit.
Das ist keine Übertreibung. Es ist ein sozialer Automatismus, der so tief sitzt, dass wir ihn kaum noch bemerken. Man sagt es im Vorbeigehen, in der U-Bahn, beim Einkaufen, im Büro. Der Körper reagiert von allein: Lächeln, Nicken, Weitergehen. Die Zunge ist schneller als das Herz. Wir fragen, ohne wissen zu wollen – und antworten, ohne etwas zu sagen.
Der Soziologe Erving Goffman nannte das „Fassadenarbeit" – wir spielen Rollen, um soziale Interaktionen zu erleichtern. „Wie geht's?" ist Teil dieser Fassade, eine rituelle Geste, die signalisiert: Ich nehme dich wahr. Ich bin höflich. Ich erfülle meine soziale Pflicht. Mehr nicht.
Das Problem: Diese Fassade schützt uns zwar vor Unbehagen, aber sie macht uns auch einsam. Denn hinter der Floskel steckt eine stille Übereinkunft: Wir tun beide so, als wäre alles in Ordnung. Und wenn einer von uns diese Übereinkunft bricht – wenn jemand ehrlich antwortet –, kollabiert das System. Dann steht man da, überfordert, weil man plötzlich mehr bekommt, als man erwartet hat.
Ich habe das selbst erlebt. Jemand hat mir auf mein oberflächliches „Wie geht's?" ehrlich geantwortet. Und ich war perplex. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte keine Zeit, kein emotionales Budget für eine echte Antwort. Also tat ich, was die meisten tun: Ich lächelte, murmelte etwas Aufmunterndes und ging weiter.
Später kamen die Schuldgefühle. Die Scham. Weil ich merkte: Ich bin nicht besser. Ich spiele dieselbe Rolle. Ich stelle Fragen, die ich nicht meine. Ich verlange Ehrlichkeit, die ich selbst nicht gebe.
[Gespräche mit Freund*innen – wenn selbst Nähe nicht reicht]
Bei Fremden kann man sich hinter „Passt schon" verstecken. Bei Freund*innen wird es komplizierter.
Denn gute Freund*innen merken, wenn man lügt. Sie fragen nach. Sie wollen wirklich wissen, wie es einem geht. Und genau das ist das Problem.
Ich habe versucht, ehrlich zu sein. Ein paar Mal. Habe angefangen zu erzählen, wie es mir wirklich geht. Dass ich nicht aus dem Bett komme. Dass ich mich in Traumwelten flüchte, weil die Realität zu schwer ist. Dass ich nicht mehr weiß, wie ich durch die Woche kommen soll.
Sie hören zu. Wirklich. Aber irgendwann sehe ich es in ihren Gesichtern: eine kleine Hilflosigkeit. Eine Überforderung. Ein stilles: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Und dann kommt meistens einer dieser Sätze:
„Es wird wieder besser."
„Du solltest mehr rausgehen."
„Weißt eh, anderen geht's auch nicht immer so gut."
Und weißt du was? Sie haben nicht komplett unrecht. Ein Funken Wahrheit steckt in jedem dieser Sätze. Das Leben bewegt sich. Es gibt Hochs und Tiefs. Manchmal hilft Bewegung. Und ja, viele Menschen leiden – das kann tröstlich sein, zu wissen, dass man nicht allein ist.
Aber in dem Moment, wenn man gerade im Tal sitzt und die Dunkelheit so dicht ist, dass man die Hand vor Augen nicht sieht – da hilft dieser Funken Wahrheit nicht. Weil das Problem nicht ist, dass man es nicht weiß. Sondern dass man es nicht spüren kann.
„Es wird wieder besser" mag stimmen. Aber es ändert nichts daran, dass es jetzt gerade unerträglich ist.
Das ist nicht böse gemeint. Im Gegenteil. Aber es hilft nicht. Weil es keine Lösungen sind, sondern reflexartige Versuche, das Unbehagen des Gegenübers zu lindern. Sie wollen, dass das Gespräch wieder leichter wird. Dass ich ihnen die Last abnehme, mit meinem Schmerz umgehen zu müssen.
Depression ist schwer zu greifen. Man kann sie nicht reparieren mit guten Ratschlägen. Man kann sie nicht wegtrösten. Und ich weiß, dass meine Freund*innen das Beste wollen. Aber manchmal entsteht trotzdem das Gefühl: Ich bin zu viel. Mein Schmerz ist zu groß. Ich sollte ihn für mich behalten.
Also ziehe ich mich zurück. Antworte wieder mit „Passt schon". Und merke, wie die Distanz wächst. Nicht, weil sie mich nicht mögen. Sondern weil ich gelernt habe: Ehrlichkeit kann einsam machen.
Ich weiß, dass es sie überfordert, weil ich mich selbst nicht verstehe. Denn Depression ist schwer zu erklären – auch mir selbst.
[Depression: Was es wirklich heißt, nicht zu funktionieren]
Depression ist nicht Traurigkeit. Traurigkeit ist ein Gefühl. Depression ist die Abwesenheit von Gefühl. Es ist eine Leere. Ein Grau, das alles überzieht.
Ich leide seit meiner Jugend an Depressionen. Meine Mutter auch schon vor mir – sie war schwer depressiv und ist verstorben. Frühe Belastungen in meiner Kindheit haben wahrscheinlich ihren Teil dazu beigetragen, aber darüber werde ich an anderer Stelle ausführlicher schreiben. Ich dachte lange, das wäre Vergangenheit, 2017, als es mir besser ging. Aber Depression ist keine Grippe, die man einmal durchmacht und dann ist man immun. Sie kommt zurück. Leise. Schleichend. Und plötzlich liegt man wieder da und denkt: Nicht schon wieder.
Das ist jetzt, Jahre später, eine Erkenntnis, die bitter und befreiend zugleich ist: Depression ist für mich ein chronisches Thema. Ein Begleiter, der mal leiser, mal lauter wird. In der Zwischenzeit hatte ich Krisen, die schlimmer waren als damals, als ich den ersten Entwurf dieses Textes schrieb. Aber ich verstehe jetzt besser, was mit mir passiert. Ich erkenne die Muster früher. Das macht es nicht leichter. Aber es macht es weniger fremd.
Wichtig zu wissen: Depressionsverläufe sind sehr unterschiedlich. Bei manchen Menschen klingt eine depressive Episode nach Wochen oder Monaten wieder ab und kehrt nie zurück. Andere erleben wiederkehrende Episoden über Jahre hinweg. Wieder andere – wie ich – leben mit einer chronischen Form, bei der die Symptome über lange Zeiträume bestehen bleiben. Es gibt Menschen, die 40 Jahre und länger mit Depression leben. Etwa 15–25 Prozent der Betroffenen entwickeln einen chronischen Verlauf. Manche sprechen kaum auf Behandlungen an. Das ist keine Seltenheit. Das ist keine persönliche Schwäche, sondern die Realität dieser Erkrankung.
Es sind die stillen Tage, die einen auffressen. Nicht die dramatischen Zusammenbrüche. Sondern die Tage, an denen aufstehen zu schwer ist. Nicht weil man müde ist, sondern weil die Welt draußen zu laut, zu schnell, zu viel ist.
Manche Tage liege ich nur im Bett. Wortwörtlich. Stundenlang. Freeze. Den Kopf im Sand. Oder besser: in einer Traumwelt. Weil die Realität unerträglich ist. Weil mein Körper sich anfühlt wie Blei. Weil jeder Gedanke an die Aufgaben, die auf mich warten – Mails beantworten, einkaufen gehen, Menschen treffen –, mich erschöpft, bevor ich überhaupt angefangen habe.
Das ist aber keine Faulheit. Es ist keine Entscheidung. Das ist kein Versagen des Willens, sondern ein Kurzschluss im System. Mein Gehirn schaltet auf Notbetrieb, und dann wird selbst das Duschen zur Expedition. Die Chemie verrutscht – Serotonin, Dopamin, Noradrenalin geraten durcheinander. Der Teil, der Antrieb organisiert, streikt. Und dann sitzt man da, starrt die Wand an und denkt: Ich müsste. Aber ich kann nicht.
Ich flüchte mich in meinen Kopf. In Tagträume. In Geschichten, die ich mir erzähle. Nicht metaphorisch. Wortwörtlich. Ich lebe mehr in meiner Fantasie als in der Realität. Weil dort alles einfacher ist. Weil ich dort nicht spüren muss, wie schwer alles ist.
Und wenn dann jemand fragt: „Wie geht's?" – was soll ich sagen? Heute habe ich es geschafft, mich anzuziehen. Das ist mein Erfolg! Ich habe drei Tage nicht auf Nachrichten geantwortet, weil es mich überfordert. Ich weiß nicht, ob ich morgen aufstehen kann.
Das passt nicht in Smalltalk. Das passt nirgendwo hin.
[Wenn der Körper mitspricht – Reizüberflutung und ihre Wurzeln]
Etwa 15–20 Prozent der Menschen sind hochsensibel. In der Psychologie heißt das „Sensory Processing Sensitivity" – das Nervensystem verarbeitet Reize intensiver. Man nimmt mehr wahr. Man fühlt mehr. Man ist schneller überstimuliert.
Aber: Hypersensibilität kann auch eine Folge oder Verstärkung durch psychische Belastungen sein. Menschen, die lange mit Depression, Angststörungen oder den Folgen von Trauma leben, entwickeln oft eine erhöhte Empfindsamkeit gegenüber Reizen. Das Nervensystem ist ständig im Alarmzustand. Die Filterung von wichtigen und unwichtigen Informationen funktioniert nicht mehr richtig. Alles dringt ein. Alles ist zu viel.
Ich weiß nicht mehr genau, was zuerst da war. Ob ich von Natur aus sensibler bin oder ob die Jahre mit psychischen Kämpfen mich so gemacht haben. Wahrscheinlich beides. Was ich weiß: Ich spüre Stimmungen, bevor jemand etwas sagt. Ich merke, wenn jemand angespannt ist, traurig, wütend – auch wenn sie lächeln. Ich nehme Nuancen wahr, die anderen entgehen.
In der U-Bahn zum Beispiel. Die Lautsprecher-Durchsagen, zu schrill. Das Quietschen der Bremsen, zu durchdringend. Die Körper um mich herum, zu nah. Ich nehme alles wahr – und bin gleichzeitig wie taub vor Reizüberflutung. Mein Kopf brummt. Meine Haut kribbelt. Ich will nur noch raus.
Oder beim Einkaufen. Die Neonlichter. Die Hintergrundmusik. Die Menschen, die sich im Gang drängen. Alles zu viel. Ich kaufe schnell, was ich brauche, und gehe. Aber danach bin ich erschöpft, als hätte ich einen Marathon hinter mir.
Und wenn ich dann spüre, dass jemand mich fragt „Wie geht's?", aber eigentlich keine Antwort will – dann tut das doppelt weh. Einmal für die Oberflächlichkeit. Und einmal für die Erkenntnis, dass ich genau dasselbe tue.
Ich bin nicht besser. Ich bin genauso überfordert, wenn jemand ehrlich antwortet. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich ziehe mich auch zurück, wenn es zu viel wird.
Aber genau das macht es so schwer: Muster, die nerven – und bleiben.
Die Kombination aus Depression und Reizüberflutung ist tückisch. Die Depression macht mich leer, während die Überempfindlichkeit mich mit allem überflutet. Ich fühle zu viel und zu wenig gleichzeitig. Ich bin überstimuliert und ausgebrannt. Ich will Nähe und kann sie nicht ertragen.
Das führt zu einem Teufelskreis: Ich ziehe mich zurück, weil soziale Situationen mich überfordern. Aber der Rückzug macht die Depression schlimmer. Also zwinge ich mich, rauszugehen – wie zu dieser Veranstaltung. Aber dann merke ich: Es ist zu viel. Also ziehe ich mich wieder zurück. Und so weiter.
[Der Samariterbund – wenn Helfen zur Flucht wird]
Ich war Sanitäter beim Samariterbund. Nicht wegen der Einsätze mit Blaulicht. Sondern wegen der Momente dazwischen. Die älteren Menschen, die wir nach Hause gefahren haben. Die Gespräche im Krankentransport. Die Frau, die erzählte, dass ihr Mann gestorben war und sie nicht wusste, wie sie allein weiterleben sollte. Der Mann, der sich entschuldigte, dass er uns Umstände macht, obwohl er gerade einen Herzinfarkt hatte.
Das war es, was mir etwas gab. Diese psychosozialen Momente. Das Zwischenmenschliche. Ich habe Dinge gespürt, die anderen entgingen. Nuancen. Eine Angst, die jemand nicht aussprach. Eine Scham. Eine Einsamkeit. Manchmal habe ich mehr über den Zustand eines Menschen verstanden als Kolleg*innen, die schon Jahre dabei waren. Nicht, weil ich besser war. Sondern weil ich selbst kenne, wie es ist, wenn man sich schämt. Wenn man nicht zur Last fallen will. Wenn man nach außen funktioniert, aber innen längst zusammenbricht.
Vielleicht war ich gerade deshalb gut darin, weil ich selbst dort kämpfte.
Aber irgendwann reichte das nicht mehr. Die Krankenstände häuften sich. Einmal, zweimal, dann wieder. Ich spürte die Blicke. Die unausgesprochene Frage: Ist er belastbar? Kann man sich auf ihn verlassen? Ich wollte nicht der sein, der ausfällt. Der die Schicht platzen lässt, weil er es wieder nicht aus dem Bett schafft. Also bat ich um die Auflösung meines Dienstverhältnisses. Nicht, weil ich nicht mehr wollte – sondern weil ich nicht mehr konnte.
Erst Monate später verstand ich das Muster. Solange ich mich um andere kümmerte, musste ich mich nicht um mich selbst kümmern. Die Fürsorge für andere war einfacher als die Fürsorge für mich. Ich konnte einer fremden Frau zuhören, die ihren Mann verloren hatte. Aber ich konnte nicht mit meiner eigenen Trauer umgehen. Ich konnte jemandem die Scham nehmen, dass er Hilfe braucht. Aber ich konnte meine eigene nicht loslassen.
Helfen gibt dir das Gefühl, etwas wert zu sein – ohne dass du dich dem stellen musst, was in dir selbst kaputt ist. Du bist beschäftigt. Du bist wichtig. Du bist gebraucht. Und all das fühlt sich besser an als die Frage: Was, wenn niemand mich braucht? Was bin ich dann?
Der Abschied fühlte sich an wie Verrat. Aber vielleicht war er die erste ehrliche Entscheidung seit langem. Die erste, bei der ich zugab: Ich brauche selbst Hilfe. Ich kann nicht mehr nur geben. Ich muss auch nehmen.
Aber das zuzugeben, fühlt sich an wie Versagen.
Nach dem Abschied blieb Stille. Und in dieser Stille begann ich zu verstehen, was Zuhören wirklich heißt.
[Das Schweigen im Raum – warum Zuhören so schwer ist]
Was wir eigentlich brauchen, sind keine Antworten. Sondern Präsenz.
Schwer zu verstehen in einer Welt, die auf Lösungen getrimmt ist. Auf Effizienz. Auf Produktivität. Wir sind konditioniert, Probleme zu lösen. Also wenn jemand ein Problem hat, wollen wir es reparieren. Wir wollen helfen. Wir wollen, dass es besser wird.
Aber manchmal hilft das nicht. Manchmal macht es alles schlimmer.
Denn wenn jemand über Depression redet und sofort Ratschläge bekommt – „Hast du es mal mit Sport versucht?" „Vielleicht solltest du Vitamin D nehmen?" „Du musst positiver denken!" –, dann ist die Botschaft: Dein Schmerz ist ein Problem, das ich lösen muss, damit ich mich wieder wohlfühle.
Was wir stattdessen brauchen, ist Zuhören. Einfach nur Zuhören. Ohne zu urteilen. Ohne zu bewerten. Ohne zu reparieren.
Aber das ist unglaublich schwer. Weil Zuhören bedeutet: Ich halte deinen Schmerz aus. Ich bleibe, auch wenn es unangenehm ist. Ich ertrage die Stille. Ich ertrage das Nicht-Wissen.
Wie oft passiert das wirklich? Wie oft bleibt jemand einfach da, wenn du sagst: „Mir geht's schlecht"? Ohne Ratschläge. Ohne Aufmunterung. Ohne zu versuchen, die Situation erträglicher zu machen – für sich selbst.
Selten. Verdammt selten.
Vielleicht ist das der Kern des Problems. Wir haben verlernt, mit Schmerz umzugehen – dem anderer, aber auch unserem eigenen. Wir haben verlernt, auszuhalten, dass manchmal alles beschissen ist und man nichts dagegen tun kann. Wir haben verlernt, einfach da zu sein.
Zuhören. Hinhören. Weniger selbst reden. Das ist keine passive Rolle. Sondern eine der aktivsten Formen von Fürsorge, die es gibt. Aber sie verlangt etwas, das selten geworden ist: Aushalten.
[Der eigene Lernprozess – Bewusstsein ohne Heilung]
Ich will nicht so tun, als hätte ich das gelöst. Als wäre ich jetzt erleuchtet und könnte perfekt zuhören. Das wäre eine Pose.
Ich bin immer noch überfordert, wenn jemand ehrlich antwortet. Ich ziehe mich immer noch zurück, wenn es zu viel wird. Ich stelle immer noch Fragen, die ich nicht meine.
Aber ich bemerke es jetzt. Sehe meine eigenen Muster. Merke, wenn ich mich hinter Floskeln verstecke, wenn ich die Antwort gar nicht hören will.
Und manchmal schaffe ich es, innezuhalten. Nicht immer. Aber manchmal.
Das ist kein Fortschritt, der sich gut verkaufen lässt. Keine Erfolgsgeschichte. Keine Transformation. Nur ein langsames, mühsames Bewusstwerden.
Aber vielleicht ist das alles, was wir haben.
Bewusstsein heilt keine Depression. Es löst keine sozialen Probleme. Es macht das Leben nicht einfacher. Aber es gibt einem die Möglichkeit, anders zu handeln. Nicht immer. Aber manchmal.
Üben. Jeden Tag ein bisschen mehr.
Nicht, weil ich ein besserer Mensch werden will. Sondern weil ich ein aufmerksamerer sein will.
[Wege, die tragen können – was wirklich hilft]
Depression verläuft nicht bei allen gleich. Manche erleben einzelne Episoden, die abklingen. Andere – wie ich – leben mit einem chronischen Begleiter. Bei manchen wechseln sich Hochs und Tiefs ab. Bei anderen bleiben die Symptome über Jahre bestehen.
Das Leben bewegt sich weiter. Immer. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Auch wenn man gerade im Tal sitzt und glaubt, es gäbe keinen Weg hinaus. Die Bewegung des Lebens selbst – das Auf und Ab – kann manchmal tröstlich sein. Nicht, weil es den Schmerz wegnimmt. Sondern weil es bedeutet: Nichts ist endgültig. Weder das Glück noch die Verzweiflung.
Aber es gibt konkrete Wege, die helfen können. Nicht heilen. Nicht erlösen. Aber tragen.
Medikamente können kurzfristig – oder auch längerfristig – eine Brücke sein. Antidepressiva heilen nicht. Aber sie können den Boden unter den Füßen stabilisieren, wenn alles wegbricht. Sie sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind ein Werkzeug. Und manchmal braucht man Werkzeuge, um nicht zu ertrinken.
Ärztliche Hilfe ist notwendig. Aber der Weg dorthin kann unüberwindbar erscheinen. Einen Termin machen. Zum Termin gehen. Darüber reden. Das alles kostet Kraft, die man nicht hat, wenn man im Tal sitzt.
Therapie ist kein Allheilmittel. Aber sie kann Raum schaffen, um die Muster zu verstehen. Bei chronischer Depression gibt es spezielle Ansätze wie CBASP, die gezielt an den Beziehungsmustern arbeiten, die oft schon in der Kindheit entstanden sind.
Deshalb ist das Wichtigste, was Freund*innen und Angehörige tun können, nicht, gute Ratschläge zu geben. Nicht, aufmunternde Worte zu sagen. Sondern: proaktiv zu werden.
Jemanden aus dem Bett holen. Nicht metaphorisch. Wortwörtlich. Vorbeikommen. Klingeln. Dranbleiben.
Jemanden zum Arzt begleiten. Den Termin gemeinsam vereinbaren. Mitgehen. Draußen warten, wenn nötig. Aber da sein.
Jemanden zum Therapeuten bringen. Manchmal braucht man jemanden, der einen dorthin begleitet, weil der Weg allein zu schwer ist.
Das sind keine heroischen Gesten. Das sind kleine, konkrete Handlungen. Aber sie können den Unterschied machen zwischen „Ich schaffe das nicht" und „Ich versuche es".
Depression isoliert. Sie macht einen glauben, man wäre allein. Man wäre zu viel. Man wäre eine Last.
Aber manchmal reicht es, wenn jemand bleibt. Wenn jemand sagt: „Ich gehe mit dir." Nicht: „Du schaffst das." Sondern: „Wir gehen gemeinsam."
Das ist keine Lösung. Aber es ist ein Anfang.
[Was du wissen solltest – für Betroffene und Angehörige]
Wenn du selbst betroffen bist:
Depression ist vielschichtig. Manche Menschen erleben einzelne Episoden, die vorübergehen. Andere leben jahrzehntelang damit. Etwa 25–30 Prozent aller Depressionen nehmen einen chronischen Verlauf. Das bedeutet nicht, dass es keine Besserung geben kann. Aber es bedeutet, dass die Vorstellung „es geht vorbei" manchmal nicht reicht.
Viele Menschen mit Depression haben auch andere psychische Erkrankungen – Angststörungen, ADHS, Traumafolgen. Das nennt man Komorbiditäten. Sogar mehr als die Hälfte der Betroffenen hat mindestens eine weitere Diagnose. Das macht die Behandlung komplexer. Aber es bedeutet nicht, dass man „unheilbar" ist. Es bedeutet, dass man einen individuellen Weg finden muss.
Du bist nicht allein. Du bist nicht zu viel. Dein Schmerz ist real.
Wenn jemand in deinem Umfeld betroffen ist:
Hör zu. Ohne zu reparieren. Ohne Ratschläge. Einfach da sein.
Sei proaktiv. Frag nicht nur „Was kann ich tun?" – tu etwas. Komm vorbei. Bring Essen mit. Begleite zum Arzt. Bleib, auch wenn es unangenehm ist.
Respektiere, dass Depression viele Gesichter hat. Manche kämpfen ein Leben lang damit. Das ist keine persönliche Schwäche. Das ist die Realität dieser Erkrankung.
Und wenn du selbst überfordert bist – auch das ist okay. Sag es. Hol dir selbst Unterstützung. Du kannst nicht alles tragen. Aber du kannst da sein.
[Schluss]
Ich weiß nicht, ob Depression jemals ganz verschwindet. Bei manchen ja. Bei anderen nicht. Bei mir ist sie ein chronischer Begleiter. Sie wird leiser, dann wieder lauter. Manchmal habe ich Monate, in denen ich atmen kann. In denen ich lebe, nicht nur überlebe.
Und dann kommen wieder die Tage, an denen aufstehen zu schwer ist. An denen ich im Bett liege und denke: Nicht schon wieder.
Aber ich weiß jetzt, dass das Leben weitergeht. Nicht, weil ich stark bin. Sondern weil das Leben sich einfach bewegt. Ob man will oder nicht.
In den Tälern brauche ich kein Mitleid. Ich brauche keine großen Worte. Keine schnellen Lösungen.
Ich brauche nur Menschen, die aushalten, dass es mir nicht gut geht. Die nicht sofort versuchen, mich zu reparieren. Die einfach da sind. Die zuhören. Die hinhören. Die weniger selbst reden und mehr Raum geben.
Vielleicht ist das das Einzige, was zählt: dass wir manchmal stehenbleiben. Dass wir zuhören. Nicht, um zu antworten, sondern um da zu sein.
Ich übe das. Scheitere daran. Übe weiter. Wie jemand, der das Gehen neu lernt – jeden Tag, Schritt für Schritt.
Und wenn du jemanden kennst, der gerade im Tal sitzt: Geh hin. Sei da. Hör zu. Und wenn nötig: Nimm die Hand und geh mit zum Arzt. Es hilft. Danke!

Schon eine kleine Spende hilft mir, Zeit fürs Schreiben zu reservieren. Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Dorian Rammer
